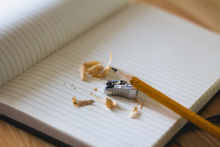Mitforschen auf dem Fahrrad: Das Ulmer Netzwerk für Bürgerwissenschaften unterwegs an der Donau

von Dorothee Hoffmann
An Pfingsten 2025 radelte das Ulmer Netzwerk für Bürgerwissenschaften eine Woche lang von Passau bis Wien. Rund 400 Kilometer legte die gemischte Gruppe aus Wissenschaftler*innen, Citizen Scientists und Ehrenamtlichen zurück – mit einem klaren Ziel: Daten sammeln, sich austauschen und Citizen Science sichtbar machen.
Im Team vertreten waren die Technische Hochschule Ulm, der ADFC Ulm/Alb-Donau, das ZAWiW (Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung) der Universität Ulm sowie der Botanische Garten Ulm. Gefördert wurde die Tour durch den DATIpilot sowie die Hans-Sauer-Stiftung, die das Ulmer Netzwerk für Bürgerwissenschaften im Rahmen der Aktion „Ulm forscht gemeinsam“ im Jahr 2025 unterstützt.
Die Idee zur Tour entstand bei einem Netzwerktreffen. Die Technische Hochschule Ulm mit dem Team rund um Prof. Thomas Walter plante im Rahmen des Projekts SICURA den Einsatz neuer Sensoren zur Erfassung von Radwegeschäden. Stefan Brändel vom Botanischen Garten schlug vor, zusätzlich mit der App iNaturalist die Artenvielfalt entlang der Donau zu dokumentieren. Norbert Schulz vom ADFC, engagierter Citizen Scientist und begeisterter Radfahrer, übernahm die Routenplanung. Ich kümmerte mich um Pressearbeit und nahm Kontakt zu Citizen-Science-Projekten in Österreich auf. Die Zusammenarbeit im Vorfeld und während der Reise funktionierte gut – alle Beteiligten konnten ihre Ideen und Kompetenzen einbringen.
Forschung unterwegs: Technik auf zwei und drei Rädern
Die Messungen entlang der Strecke erfolgten mit einem Spezialfahrrad mit mobiler Sensorplattform. Damit wurden sowohl die Beschaffenheit der Straßenoberfläche als auch die Umgebung erfasst. Zum Einsatz kamen:
- Zwei nach unten gerichtete Stereo-Tiefenkameras im Abstand von einem Meter: Sie lieferten synchronisierte RGB-Bilder, Tiefeninformationen und IMU-Daten – ideal zur Erkennung feiner Unebenheiten wie Risse oder Schlaglöcher.
- Eine 360°-RGB-Kamera, die je nach Position (Lenker oder Heckstange) Rundumblick oder eine drohnenähnliche Perspektive ermöglichte.
- Ein LiDAR-Sensor zur kontinuierlichen Distanzmessung und räumlichen Darstellung der Umgebung.
- Ein GPS-Modul zur präzisen Verortung aller Daten.
- Eine autarke Stromversorgung über ein Solarpanel auf dem Dach – für nachhaltigen Betrieb unterwegs.
Die erhobenen Daten wurden synchronisiert und in Videosequenzen aufbereitet. Besonders die Kombination von 360°-Aufnahmen und LiDAR-Messungen ermöglichte eine anschauliche Analyse des Streckenzustands. Ziel war es, verlässliche und flächendeckende Daten zur Radinfrastruktur zu gewinnen – denn bisher fehlen solche Datengrundlagen vielerorts. Das SICURA-System bietet hier eine innovative Lösung, die Mobilität mit präziser Technik und partizipativem Potenzial verbindet.

Ergänzt wurde das Setup durch ein solarbetriebenes Citkar – ein dreirädriges Mini-Elektrofahrzeug mit acht semiflexiblen Photovoltaikmodulen (rund 650 Watt Peak Gesamtleistung). Die Module waren auf Dach und Seitenflächen montiert, jeweils paarweise verschaltet und parallel verbunden, um auch bei wechselnder Sonneneinstrahlung eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Bei gutem Wetter wurden Leistungen von über 300 Watt gemessen. Die Tour war der erste mehrtägige Praxistest für das Solarmobil – bei optimalen Bedingungen wären Etappen von bis zu 90 Kilometern pro Tag möglich gewesen.
Die auffällige Technik erregte unterwegs viel Aufmerksamkeit. Immer wieder kamen Passant*innen mit der Gruppe ins Gespräch, informierten sich über Technik, Ziele und Hintergründe – und begegneten dabei oft erstmals der Idee von Bürgerwissenschaft.
Artenvielfalt dokumentieren: Biodiversitätsforschung am Wegesrand
Neben den technischen Erhebungen lag ein zweiter Schwerpunkt auf der Erfassung der Biodiversität entlang des Weges. Stefan vom Botanischen Garten hatte kleine Forschungs-Challenges vorbereitet, die die Gruppe bei Pausen am Donauufer umsetzte. Mithilfe der App iNaturalist entstanden 468 Beobachtungen von 297 Arten – darunter:
- 179 Pflanzenarten, etwa Klatschmohn, Gelber Lein, Esparsetten-Tragant und Echtes Federgras
- Reptilien wie Äskulapnatter, Ringelnatter und Würfelnatter – zum Teil direkt auf dem Weg
- Vögel wie Pirol, Goldammer, Fasan und Gelbspötter
- Säugetiere am frühen Morgen: Rehe, Hasen, Biber – und bei Wien sogar Ziesel!
Die Beobachtungen leisten einen wertvollen Beitrag zur offenen Biodiversitätsforschung und liefern Hinweise zur Artenzusammensetzung entlang des Donau-Radwegs.
Begegnungen in Österreich: Citizen Science vernetzt
Ein besonderer Höhepunkt war der Austausch mit österreichischen Citizen-Science-Initiativen. Auf einen Aufruf über den Verteiler von Österreich forscht meldeten sich zahlreiche engagierte Projektakteur*innen.
In Krems berichtete Martin Scheuch von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik über das Projekt Kremser Skorpion. Seit 2017 wird dort – gemeinsam mit dem Naturhistorischen Museum Wien und Schüler*innen des Bundesrealgymnasium Krems – das nördlichste Vorkommen des Triestiner Skorpions (Euscorpius tergestinus) untersucht. Bürger*innen meldeten Sichtungen über Fragebögen, Kartierungen fanden in Gärten und auf Grünflächen statt. Die Jugendlichen erlernten wissenschaftliches Arbeiten und publizierten eigene Artikel. Die Einbindung der Schülerschaft trug wesentlich dazu bei, die Kremser Bevölkerung für das Projekt zu sensibilisieren und zu beteiligen.
In Wien besuchte die Grupe GeoSphere Austria, die nationale meteorologische und geophysikalische Einrichtung. Meteorologe Thomas Krennert stellte vier Citizen-Science-Projekte vor:
- wettermelden.at: Eine Plattform zur Meldung von Wetterphänomenen wie Starkregen oder Hagel – inklusive Fotodokumentation.
- Trusted Spotter Network Austria: Ein Netzwerk geschulter Bürger*innen, deren standardisierte Meldungen direkt ins meteorologische Monitoring einfließen.
- quakewatch.at: Ein Projekt zur Erfassung subjektiver Erdbebenwahrnehmungen durch die Bevölkerung.
- naturkalender.at: Eine Plattform für phänologische Beobachtungen wie Blühbeginn oder Blattverfärbung – wichtige Daten für die Klimaforschung.
Die Ulmer Delegation erhielt zudem Einblick in das Operation Center, in dem Meldungen von Bürger*innen tagesaktuell in die Wetteranalyse einfließen. Der Besuch zeigte eindrucksvoll, wie niederschwellige Beteiligung und wissenschaftliche Verwertbarkeit erfolgreich kombiniert werden können.

Mit dem Projekt DANUBE4all, einem Horizon-Europe-Vorhaben zur Renaturierung der Donau, diskutierte die Gruppe abschließend die Rolle von Citizen Science bei großräumigen ökologischen Maßnahmen. Demonstrationsprojekte zur Wiederanbindung von Seitenarmen oder zur Ufersicherung werden an mehreren Standorten mit aktiver Beteiligung von Bürger*innen umgesetzt. Ergänzt wird das Projekt durch digitale Tools wie GIS-Anwendungen und Beobachtungsplattformen. Auch Ideen für gemeinsame Aktionen entlang der Donau wurden skizziert – Ulm als Donau-Stadt ist Teil dieses internationalen Flussraums.
Zurück in Ulm: Wie geht es weiter?
Die Resonanz auf die Tour war durchweg positiv. In Ulm wurde die tägliche Berichterstattung aufmerksam verfolgt, Hochschulen und städtische Einrichtungen unterstützten die Öffentlichkeitsarbeit. Die Lokalpresse berichtete vor dem Start und nach der Rückkehr. Viele zeigten sich begeistert von der Idee – einige äußerten bereits Interesse, bei einer Wiederholung dabei zu sein. Für die Beteiligten war die Reise weit mehr als ein Forschungsprojekt: Sie wurde zum Erfahrungsraum für Austausch, Zusammenarbeit und spontane Begegnungen entlang des Weges.
Auch künftig bleibt das Netzwerk aktiv:
Am 20. November 2025 findet im Ulmer Stadthaus ein „Citizen Science Slam“ statt, bei dem sich bürgerwissenschaftliche Projekte aus der Region mit eigenen unterhaltsamen Kurzbeiträgen auf der großen Bühne vorstellen.
Eine weitere Radtour soll auch stattfinden! Hierbei könnte der Fokus auf Wasserqualität und Pegelständen entlang der Donau liegen. Auch neue Kooperationen mit Partner*innen entlang des Flusses sind im Gespräch.
Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Ulmer Netzwerk für Bürgerwissenschaften.
Instagram: @ulm.forscht.gemeinsam
Über die Gastautorin:
Dorothee Hoffmann ist akademische Mitarbeiterin am Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm. Im Ulmer Netzwerk für Bürgerwissenschaften koordiniert sie Veranstaltungen und bringt Menschen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Als studierte Erwachsenenbildnerin interessiert sie sich besonders für die Frage, wie gemeinsames Lernen in Citizen-Science-Projekten gelingen kann.