Bibliotheken & Archive: Über strategische Entwicklung und Vernetzung mit Stefan Wiederkehr
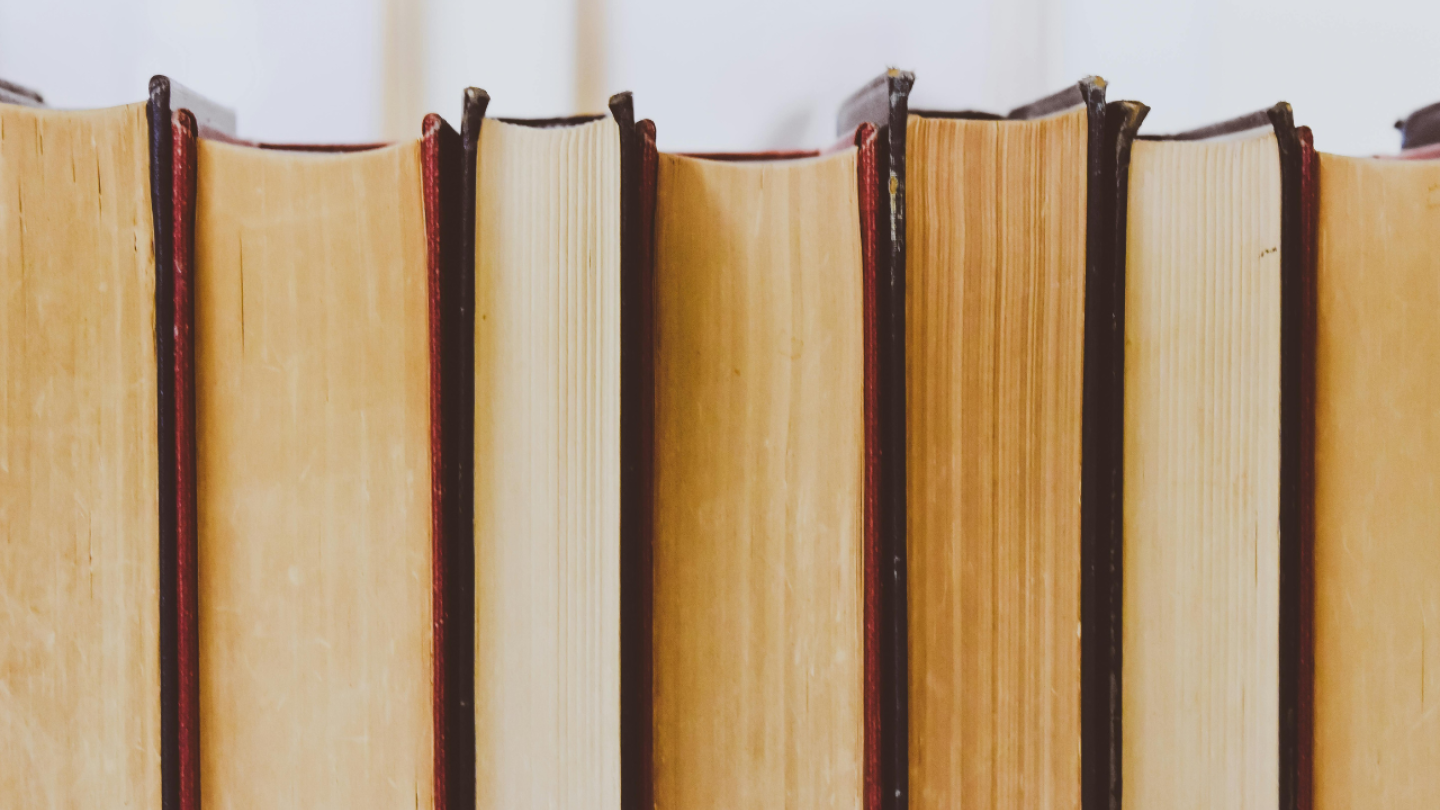
Stefan Wiederkehr ist Chefbibliothekar Spezialsammlungen und Digitalisierung an der Zentralbibliothek Zürich und engagiert sich in der LIBER Citizen Science Working Group. Für unsere Reihe „Bibliotheken & Archive” haben wir mit ihm über die Besonderheiten von Bibliotheken als Akteurinnen im Bereich Citizen Science und die Bedeutung strategischer Vernetzung gesprochen.
Welche Rolle spielt Citizen Science in der Zentralbibliothek Zürich?
Wiederkehr: Wir haben das Handlungsfeld Citizen Science an der Zentralbibliothek Zürich in der letzten Strategieperiode in einem größeren Projekt systematisch aufgebaut. Dabei standen uns interne Sondermittel zur Verfügung. Seit diesem Jahr haben wir das Thema mit Stellenprozenten und Sachmitteln auch im regulären Betrieb unserer Bibliothek finanziell verankert. Der Impuls zum Aufbau des Handlungsfelds Citizen Science ging von der Direktion und von der Geschäftsleitung aus. Schließlich prädestiniert die Doppelrolle als öffentliche Bibliothek, das heißt als Kantons- und Stadtbibliothek, auf der einen Seite und als Universitätsbibliothek auf der anderen Seite, die Zentralbibliothek dazu, neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und breiter Öffentlichkeit zu realisieren. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt unserer bürgerwissenschaftlichen Aktivitäten beim Crowdsourcing, insbesondere beim Transkribieren und beim Georeferenzieren. Wir haben aber auch mit der partizipativen Erstellung von Open Educational Resources und mit kollaborativem Schreiben experimentiert.
Welche besonderen Ressourcen oder Kompetenzen bringen Bibliotheken und Archive für ein Engagement im Bereich Citizen Science mit?
Wiederkehr: Für Projekte, die von Bibliotheken oder Archiven initiiert werden, ist eine Nähe zum eigenen Bestand typisch. Mit der Digitalisierung der Sammlungen und deren Publikation auf längerfristig gesicherten Plattformen ist es möglich geworden, losgelöst von Raum und Zeit mit diesen zu arbeiten. Das hat eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten für Citizen Science eröffnet. Ein weiterer besonderer Punkt ist, dass die Kontakte zu den potenziellen Citizen Scientists bereits bestehen, denn Bibliotheken haben eine große Zahl eingeschriebener Nutzerinnen und Nutzer. Nicht zuletzt verfügen Bibliotheken und Archive über eine institutionelle Stabilität, sowohl was die Infrastrukturen als auch was kompetentes Personal betrifft. Diese Stabilität erlaubt ihnen, die Resultate von Citizen-Science-Projekten langfristig zu sichern.
Viele Citizen-Science-Projekte von Bibliotheken und Archiven haben einen Crowdsourcing-Schwerpunkt. Du hast schon gesagt, dass das bei euch in Zürich auch so ist. Woran liegt das? Welche Möglichkeiten haben Bibliotheken und Archive, Citizen Scientists tiefer einzubinden?
Wiederkehr: Wenn eine Bibliothek ein Projekt selbst initiiert, dann geht sie in der Regel von ihrem eigenen Bestand aus. Da ist es recht schwierig, vom Crowdsourcing wegzukommen. Auch weil Bibliotheken auf neutrale Vermittlung und Information angelegt sind und normalerweise keine thesengeleiteten wissenschaftlichen Fragestellungen verfolgen. Wenn die Bibliotheken an ihrer Kernidentität festhalten, gibt es da meiner Meinung nach eine natürliche Grenze. Es gibt aber Chancen, sich weiter zu öffnen, zum Beispiel mit der Methode des kollaborativen Schreibens. So können zum Beispiel Staats- oder Landesbibliotheken die Geschichte ihrer Region gemeinsam mit Freiwilligen aufarbeiten.
Welche Herausforderungen gibt es, wenn Bibliotheken und Archive Citizen-Science-Projekte initiieren oder unterstützen?
Wiederkehr: Wenn man als Bibliothek ein Projekt initiiert, kann es eine Herausforderung sein, hauptamtliche Forschenden dafür zu gewinnen. Denen ist der Crowdsourcing-Charakter der Projekte zum Teil schlicht zu wenig wissenschaftlich. Wenn die Initiative von den Forschenden ausgeht, beginnen diese meist mit einer Fragestellung, nicht wie wir mit einem Bestand. Ist für die Fragestellung der Bestand einer weiteren Institution relevant, kann es schwierig sein, diesen in Tools der Bibliothek zu integrieren. Ansonsten bietet die Unterstützung durch eine Bibliothek aber viele Chancen für Forschende, denn sie bringt stabile Infrastrukturen mit. Dazu gehören zum einen Tools, die längerfristig genutzt und weiterentwickelt werden können. Außerdem hat die Bibliothek vielleicht schon Know-How zur Gewinnung und Motivation von Citizen Scientists aufgebaut. Immer mehr Forschungsbibliotheken bieten auch Schulungen und Kurse zu Citizen Science für Forschende an.
Du engagierst dich in der LIBER Citizen Science Working Group, also der Arbeitsgruppe für Bürgerwissenschaften des europäischen Verbands der Forschungsbibliotheken. Welche Ziele verfolgt die Gruppe und wie arbeitet ihr?
Wiederkehr: Die Arbeitsgruppe hat das Mandat, Citizen Science als eine Spielart von Open Science zu fördern und im Kontext von Forschungsbibliotheken zu verankern. Dazu lobbyieren wir bei Förderorganisationen und wissenschaftlichen Entscheidungsträgern, bieten Schulungen für Mitarbeitende von Bibliotheken an und stellen verschiedene Hilfsmittel bereit. Wir treffen uns einmal im Jahr vor Ort am Rande der LIBER-Konferenz und sonst einmal pro Monat digital. Es haben sich auch eine Reihe von Untergruppen gebildet, die die einzelnen Themen vorantreiben und separate Meetings abhalten.
Die LIBER Citizen Science Working Group veröffentlicht einen mehrteiligen Citizen-Science-Guide, um Bibliotheken bei der Umsetzung von Citizen-Science-Projekten zu unterstützen. Wie können Bibliotheken diesen Leitfaden in ihrer täglichen Arbeit nutzen?
Wiederkehr: Die lokalen Voraussetzungen für Citizen Science sind je nach Bibliothek und Land sehr verschieden. Wie ist eine Bibliothek ins nationale Wissenschaftssystem eingebunden? Welche Aktivitäten einer Bibliothek sind ausdrücklich erwünscht? Welcher Spielraum besteht bei eigenen Aktivitäten? Welche Nischen sind schon von anderen besetzt? Wo gibt es eine besonders gravierende Lücke? Der Guide versucht, in kurzen Texten mit einer Mischung aus Theorie und Praxisbeispielen in die Vielfalt der Themen und Fragestellungen einzuführen. Ausgehend von den eigenen lokalen Verhältnissen kann man sich das herausgreifen, was einem wirklich nützt.
Welche Entwicklungen oder Trends werden das Engagement von Bibliotheken im Bereich Citizen Science in den nächsten Jahren besonders prägen?
Wiederkehr: Künstliche Intelligenz wird den Charakter von Crowdsourcing-Projekten stark verändern. Mittelfristig wird es wahrscheinlich nicht mehr hauptsächlich darum gehen, Texte zu transkribieren oder Namen und Geografika darin zu identifizieren, sondern darum, die Resultate von Handwritten-Text- oder Named-Entity-Recognition-Tools zu korrigieren. Ähnlich wird es in Projekten sein, die sich mit Fotografien oder anderem Bildmaterial auseinandersetzen. Man kann die Citizen Scientists dann aber in die Erstellung von Trainingsmaterial für das maschinelle Lernen einbinden. In diesem Bereich lohnt sich ein Engagement für Bibliotheken besonders, weil KI auch unabhängig von Citizen Science eine ganz wichtige Rolle für die Zukunft dieser Institutionen spielen wird.
Welche Bedarfe haben Forschungsbibliotheken in Europa, damit Citizen Science Teil ihrer Leitbilder und ihres Selbstverständnisses werden kann?
Wiederkehr: Es braucht vor allem eine Verankerung von Citizen Science in den Förderprogrammen der Wissenschaftsorganisationen. Heute ist es ja noch oft so, dass eine echte Kooperation zwischen Citizen Scientists und Forschenden durch die Maschen der Förderprogramme fällt und aus formalen Gründen gar nicht bewilligungsfähig ist, gerade bei „Extreme Citizen Science“ im Sinne von Muki Haklay und Co-Design-Projekten. Außerdem braucht es auch innerhalb von vielen Bibliotheken einen Wandel. Es gibt Institutionen, wo recht viel Überzeugungsarbeit bei der jeweiligen Leitung geleistet werden muss, dass Citizen Science ein sinnvolles Betätigungsfeld ist. Dabei ist Citizen Science einer der Bereiche, in denen sich Forschungsbibliotheken als echte Partner der Forschung profilieren können.
Wie können sich interessierte Bibliotheken oder Archive am besten in Citizen-Science-Initiativen einbringen und sich international strategisch vernetzen?
Wiederkehr: Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, in internationalen Verbänden und Organisationen mitzuwirken. Da gibt es zum einen die bibliothekarischen Zusammenschlüsse, wie eben die Citizen Science Working Group innerhalb von LIBER. Es gibt außerdem nationale und internationale Citizen-Science-Netzwerke ohne direkten Bibliotheksbezug, so wie euch bei mit:forschen!, Österreich forscht, Schweiz forscht oder die European Citizen Science Association. Alle diese Netzwerke führen auch regelmäßige Konferenzen durch und man kann sich über sie auch aus dem Bibliothekswesen in Richtung Citizen-Science-Community begeben. Daneben halte ich es für zentral, in die spezifischen Fachdisziplinen reinzugehen, etwa indem man im nicht-bibliothekarischen Kontext publiziert oder an Fachkongressen präsent ist. Martin Munke von der SLUB Dresden und ich haben zum Beispiel beim Historikertag 2023 ein Citizen-Science-Panel aufgebaut und so den Sprung aus der bibliothekarischen Fachwelt und auch aus der Citizen-Science-Community heraus in die Geschichtswissenschaft gewagt. Ich kann allen Interessierten nur dazu raten, Citizen Science mal auszuprobieren. Citizen Science ist wichtig. Und macht Spaß!
