Hört uns zu!

Themen
Ort
Projektzeitraum ab
Projektende
Zur Projektseite
Kontakt

Sabrina Fuths
E-Mail sendenInstitution
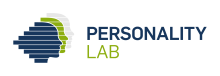
Lehrstuhl Persönlichkeitspsychologie, Ruhr-Universität

Hilda-Heinemann Schule
Häufige Fragen
Worum geht es in diesem Projekt?
Wir erforschen gemeinsam mit Eltern von Kindern mit Behinderungen, welche Barrieren sie im Kontakt mit Ämtern, Beratungsstellen und Gesundheitseinrichtungen erleben und welche Veränderungen sie sich für eine inklusivere Stadt wünschen. Ausgangspunkt war ein Elterncafé an der Hilda-Heinemann-Schule, in dem Mütter und Väter offen über Antragskämpfe, fehlende Anerkennung ihrer Expertise und bürokratische Hürden berichteten. Bisherige Studien erfassen solche Belastungen meist nur grob und quantitativ. Unser Ziel ist, tiefer zu verstehen, wie sich diese Barrieren auf das Leben und die Selbstbestimmung von Familien auswirken und welche Lösungsansätze sie selbst sehen. Dafür setzen wir auf Citizen Science: Eltern sind nicht nur Befragte, sondern Mitforschende, deren Wissen anerkannt und genutzt wird. So wollen wir epistemische Gerechtigkeit fördern – also faire Teilhabe an Wissen und Entscheidungsprozessen – und praxisnahe Verbesserungen entwickeln.
Wie können Bürger*innen mitforschen?
Das Projekt ist inzwischen abgeschlossen; wir suchen derzeit keine Mitforschenden mehr. Unser Projekt war community-initiiert und wurde maßgeblich von Eltern getragen. Sie entwickelten die Forschungsfrage selbst und arbeiteten als Citizen Scientists nach dem Ansatz der Peer-to-Peer- und Participatory Action Research. Gemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen erarbeiteten sie in einer Fokusgruppe den Interviewleitfaden und führten anschließend selbst halbstrukturierte Interviews mit anderen Eltern – auch mit Familien, die sonst schwer Zugang zur Forschung finden. Voraussetzung war eigene Erfahrung mit dem Hilfesystem als Elternteil eines Kindes mit Behinderung. Durch die Peer-to-Peer-Interviews entstand ein vertrauter Austauschraum, getragen von geteilter Erfahrung, der tiefe Einblicke in Belastungen und deren emotionale Folgen ermöglichte.
Was passiert mit den Ergebnissen?
Die Auswertung der Interviews erfolgt derzeit durch das Forschungsteam in enger Abstimmung mit den beteiligten Eltern. Wir nutzen dafür qualitative Inhaltsanalyse – ein wissenschaftliches Verfahren, bei dem Aussagen systematisch codiert, thematisch geordnet und in größere Bedeutungszusammenhänge eingeordnet werden. Erste Ergebnisse haben wir bereits für eine Ausstellung in der Zentralbibliothek Bochum aufbereitet – bewusst an einem zentralen Ort, damit die Stimmen der Eltern öffentlich wahrgenommen werden. Parallel stehen wir in engem Austausch mit kommunalen Entscheidungsträger*innen: Die Ergebnisse werden u. a. auf der kommunalen Inklusionskonferenz vorgestellt und in Arbeitsgruppen eingebracht, die Jugendamt und Beratungsstellen inklusiver gestalten sollen. Zudem bereiten wir frei zugängliche wissenschaftliche Publikationen vor. So fließen die Erkenntnisse in lokale Veränderungsprozesse und in die fachliche Diskussion ein.
Wozu trägt die Forschung bei?
Unser Projekt verortet sich im Forschungsfeld Inklusion, soziale Gerechtigkeit und psychische Gesundheit. Es untersucht, wie Barrieren im Hilfesystem und im Sozialraum die psychischen Grundbedürfnisse von Eltern von Kindern mit Behinderung beeinträchtigen und so zu erhöhter Belastung führen – nicht primär durch das Kind selbst, sondern durch strukturelle Hürden. Ziel ist es, einen Beitrag zu nachhaltiger, inklusiver Stadtentwicklung zu leisten und soziale Ungleichheit abzubauen. Das Projekt ist interdisziplinär angelegt und verbindet Psychologie, Sozialarbeit und Sonderpädagogik. Es schafft ein starkes Argumentationsfundament für kommunale Veränderungsprozesse, Prioritätensetzung in Budgets und Sensibilisierung von Fachkräften. Gleichzeitig stärkt es das Empowerment von Eltern, die in den bestehenden Systemen oft nicht gehört werden, indem sie als aktive Wissensproduzierende auftreten und konkrete Impulse für eine inklusivere Unterstützungskultur entwickeln.
