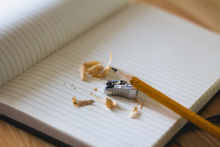Citizen Science & KI: Wie Sprache unser Bild der Technologie formt

Ein Plädoyer für sprachliche Genauigkeit zum Auftakt unserer neuen Blogreihe „Citizen Science & KI“: In ihrem Gastbeitrag zeigt Anna Henschel, warum die Metapher „Künstliche Intelligenz“ unser Verständnis der Technologie verzerrt – und wie präzisere Begriffe Hype, Angst und Missverständnissen entgegenwirken können.
von Anna Henschel
Warum klingen die Texte, die ChatGPT generiert, alle gleich?
Weil sie ein Smoothie sind – viele Zutaten werden gemischt und am Ende entsteht ein gleichförmiger Geschmack. Große Sprachmodelle verarbeiten unzählige Texte und verdichten sie zu einem Durchschnitt. Metaphern wie die vom Smoothie helfen, ihre Arbeitsweise zu erklären. Und sie zeigen, wie sehr wir auf eine Bildsprache angewiesen sind, um komplexe Technologien begreifbar zu machen. Tatsächlich wimmelt es in der Kommunikation über KI nur so von Metaphern.
Wenn Technologie vermenschlicht wird
In den Medien ist die Metapher „Künstliche Intelligenz“ allgegenwärtig. Da ist vom „Kollegen KI“ die Rede oder von Systemen, die „durchdrehen“. Illustrationen zeigen häufig leuchtende, blaue Gehirne. Bei dieser Metapher wird die menschliche Intelligenz als Modell genutzt, um das Unbekannte, die Technologie, zu erklären. Doch dieser Vergleich führt in die Irre. Sprachmodelle funktionieren nicht wie Gehirne, die menschliche Intelligenz an sich ist ein komplexes Forschungsfeld. Wenn wir auf menschliche Metaphern zurückgreifen, erzeugen wir falsche Erwartungen und tragen zu übermäßigem Hype, Angst und Missverständnissen bei.

Wie Forschende das sehen
Eine Befragung unter 60 Cyber-Valley Forschenden im Bereich maschinelles Lernen zeigt, dass die Mehrheit die „Künstliche Intelligenz”-Metapher ablehnt. Sie sei ungeeignet, um ihre Arbeit zu erklären. Eine Aussage aus der Erhebung fasst die Kritik zusammen: Künstliche Intelligenz „wird als intelligent dargestellt, obwohl sie es nicht ist. Sie wird als unvermeidlich dargestellt, obwohl es sich um Marketing handelt. Sie wird als Wissensquelle dargestellt, obwohl sie das nicht ist.“
Warum wir trotzdem an der Metapher festhalten
Die Vermenschlichung der Technologie ist naheliegend. Sie erleichtert den Zugang zu etwas Unbekanntem. Gleichzeitig wird sie von der Technologiebranche gezielt eingesetzt, um Faszination und Erwartung zu erzeugen. Begriffe wie „Intelligenz“ oder „Lernen“ verleihen der Technologie eine Aura des Lebendigen. So verankern sich die Metapher immer tiefer in der öffentlichen Wahrnehmung.
Sprache formt Wirklichkeit
Und hier liegt die Gefahr: Metaphern sind keine bloßen Stilmittel. Sie prägen, wie wir denken. Ein alltägliches Beispiel ist die Redewendung „Zeit ist Geld“. Sie verändert, wie wir über Zeit sprechen und sie empfinden: Wir investieren Zeit, verlieren sie, jemand kann sie uns stehlen. Die Sprache spiegelt also nicht nur Denken, sie gestaltet es aktiv.
Ähnlich verhält es sich mit der Mensch-Metapher in der Technologiekommunikation. Wenn Systeme als „intelligent“ oder „kreativ“ beschrieben werden, beeinflusst das die politische, juristische und gesellschaftliche Wahrnehmung. In einem für die Tech-Branche entscheidenden Urteil in den USA verglich ein Richter einen Chatbot mit einem Menschen, der „liest, um selbst Schriftsteller zu werden“. Solche Formulierungen wirken weit über den sprachlichen Rahmen hinaus.
Neue Bilder für neue Technologien
Wenn Metaphern so mächtig sind, müssen wir sorgfältiger mit ihnen umgehen. Es gibt Beispiele, wie innovative Metaphern das öffentliche Verständnis verbessern können. In der Biotechnologie zum Beispiel hat sich zur Erklärung der CRISPR-Methode die „Gen-Schere“ etabliert. Das Bild ist prägnant und vermittelt auf Anhieb, worum es geht. Die Organisation WeDoCRISPR hat diese Metapher kürzlich weiterentwickelt und CRISPR als wandelbares Pokémon „Eevee“ beschrieben – ein humorvoller Zugang, der auf Begeisterung stieß. Solche Ansätze zeigen, dass dominante Metaphern durchaus abgelöst werden können.
Die Grenzen der Vereinfachung
Metaphern sind immer eine Reduktion. Sie können Orientierung geben, aber auch eine Illusion von Verständnis erzeugen. Wenn Sprachmodelle beispielsweise als „Autocomplete-Maschinen“ beschrieben werden, vermittelt das ein unvollständiges Bild des komplexen Forschungsfeldes. Daher sollten Metaphern als Einstieg in eine komplexe Materie verstanden werden, nicht als abschließende Erklärung.
Ein reflektierter Umgang mit Metaphern kann helfen, differenzierter über Technologie zu sprechen. Hilfreiche Fragen sind etwa: Welche Gefühle weckt eine Metapher? Welche Perspektive auf die Technologie wird betont, welche ausgeblendet? Wie beschreibt die Metapher das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine?
Auch in Citizen-Science-Projekten kann das relevant sein. Wenn zum Beispiel, wie bei Hanse.Quellen.Lesen!, Anwendungen zur automatisierten Handschriftenerkennung eingesetzt werden, bietet sich vielleicht die Tool-Metapher an. Sie versteht die Technologie als Werkzeug, nicht als Wesen – ein Perspektivwechsel, der Kooperation statt Konkurrenz betont.
Mehr Präzision, weniger Buzzwords
Zum Schluss ein Plädoyer für sprachliche Genauigkeit: Das Wort „KI“ ist zu einem Sammelbegriff geworden, der alles und nichts bedeutet. Präzisere Begriffe wie beispielsweise Sprachmodell, Chatbot oder automatisiertes Diagnosesystem fördern ein klareres Verständnis. Wer präziser über Technologie spricht, versteht sie besser – und kann sie besser erklären.
Der Gastbeitrag basiert auf der Keynote von Anna Henschel beim Campus Citizen Science 2025 und ihrem Beitrag „Das Problem mit der Intelligenz”, der auf dem Portal wissenschaftskommunikation.de erschienen ist.
Anna Henschel arbeitet als Redakteurin bei wissenschaftskommunikation.de bei Wissenschaft im Dialog. Sie hat einen Doktortitel in Mensch-Roboter-Interaktion und ist eine mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin.